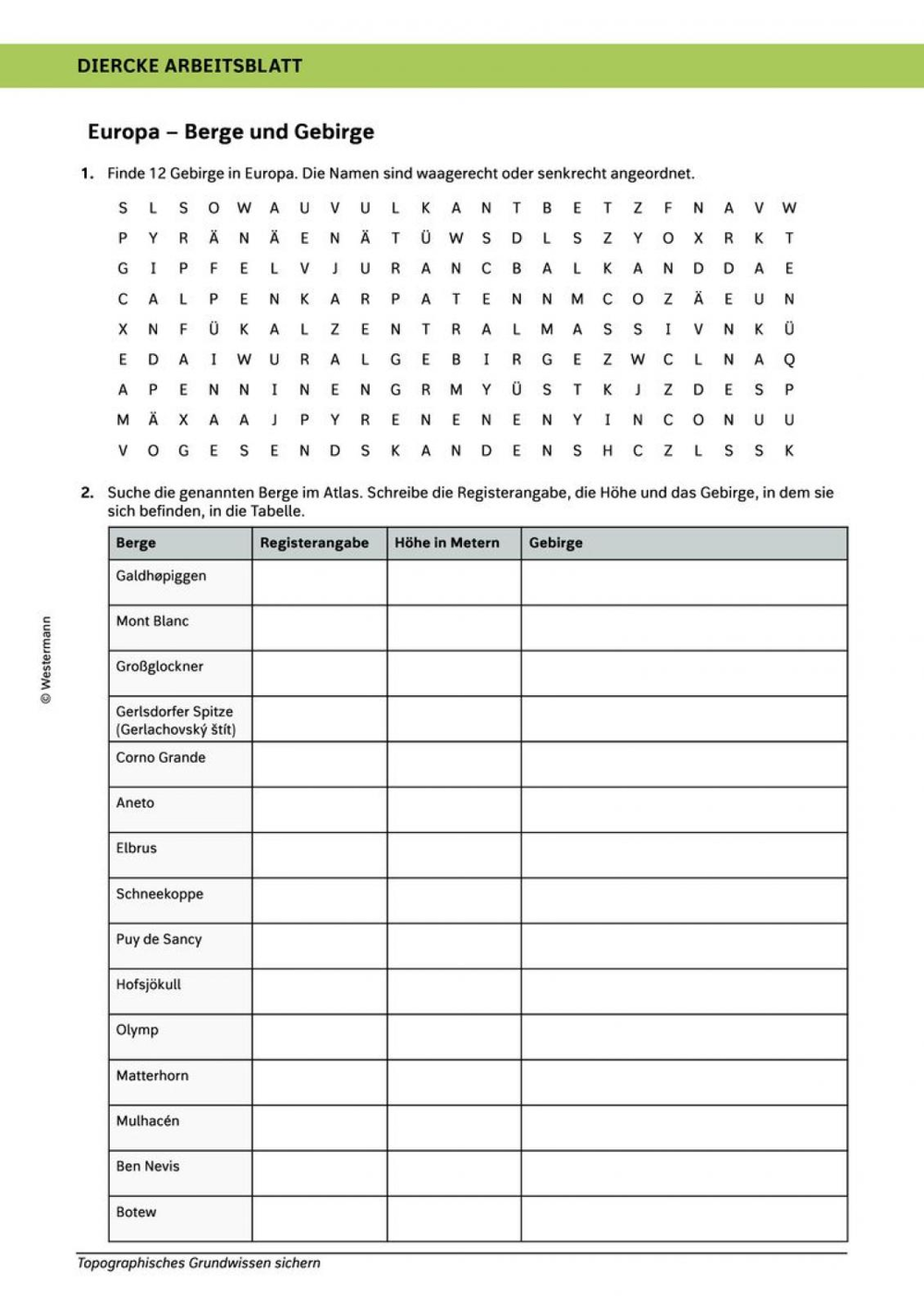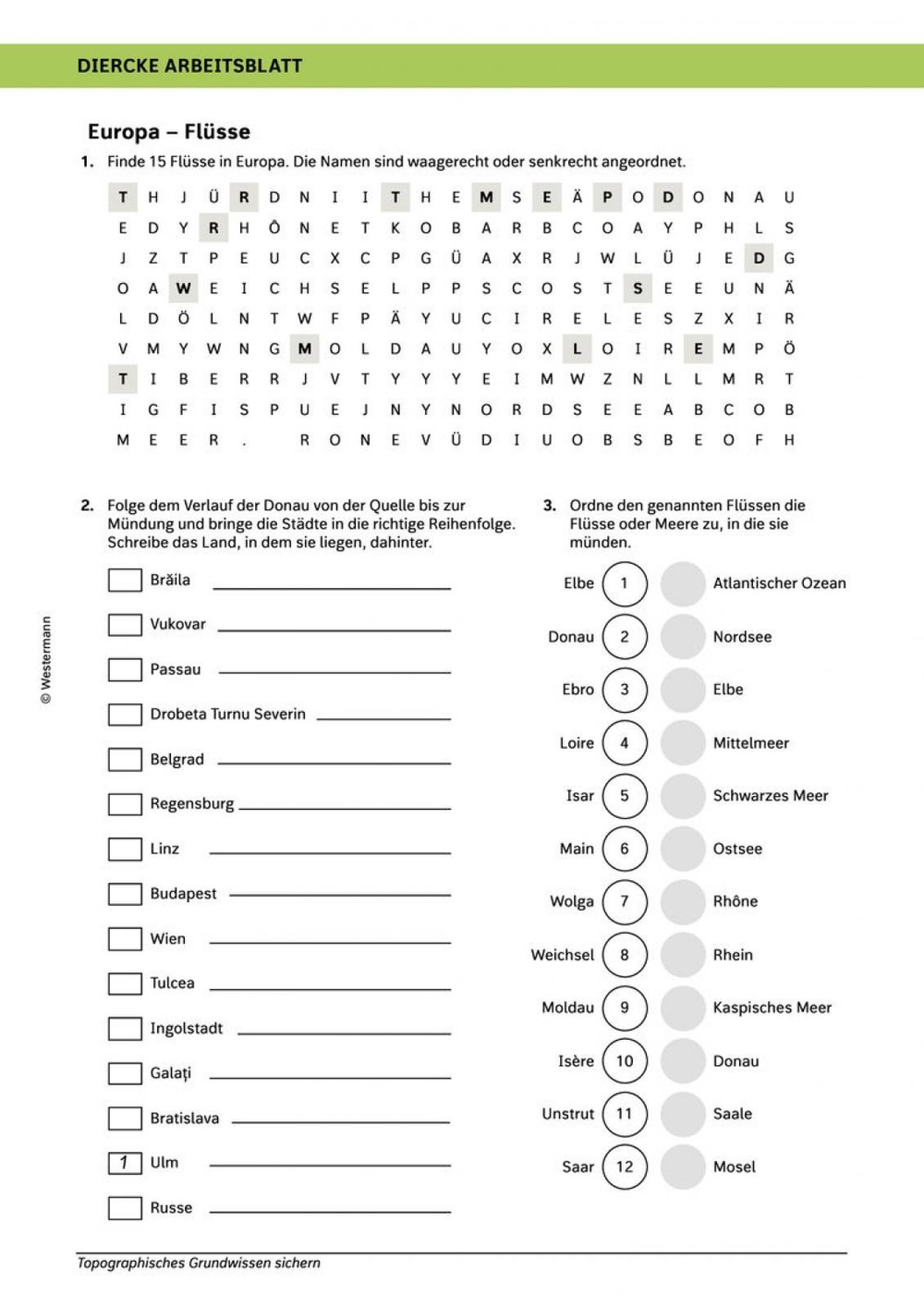Überblick
Die Karte zu West- und Mitteleuropa zeigt den Raum zwischen Dänemark im Norden, den Britischen Inseln im Westen, dem Mittelmeer im Süden sowie Polen, Belarus, der Slowakei und Ungarn im Osten. Dabei umfasst Westeuropa nach allgemeiner Auffassung die Britischen Inseln, die BENELUX-Staaten und Frankreich, während sich Mitteleuropa über Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn, sowie über Teile von Slowenien, Kroatien und der Ukraine erstreckt.
Britische Inseln
Die Britischen Inseln sitzen dem nordwesteuropäischen Kontinentalschelf auf und erstrecken sich über fast 1 300 Kilometer in Nord-Süd-Richtung und über rund 850 Kilometer in West-Ost-Richtung. Die größte Meerestiefe wird mit 272 Metern im Nordkanal zwischen Irland und Großbritannien erreicht. Neben den Hauptinseln Großbritannien und Irland gehören die Orkney-Inseln, die Shetland-Inseln, die Inneren und Äußeren Hebriden (bis auf die südlichen Inneren Hebriden alle außerhalb des Kartenausschnitts), die Inseln Man und Wight sowie viele kleinere Inseln zu den Britischen Inseln (insgesamt rund 6 000 Inseln mit rund 315 000 km2 Landfläche). Die Kanalinseln vor der Küste der Normandie hingegen zählen geografisch zum französischen Festland, politisch jedoch zu den Britischen Inseln. Das Festland der britischen Hauptinseln Großbritannien und Irland weist eine hochkomplexe Oberflächengestalt auf: Bergketten, Hochebenen, Schichtstufen und Küstenebenen lassen eine große Vielfalt an Landschaften entstehen.
Landschaften auf Großbritannien
Die mit knapp 209 500 km2 größte Hauptinsel Großbritannien wird durch den Gegensatz zwischen den flachwelligen Schichtstufenlandschaften Südostenglands und den kaledonischen bzw. variskischen Mittelgebirgen der Nord-Süd-verlaufenden Pennines, den Schottischen Highlands und den Cambrian Mountains in Wales gekennzeichnet. Insgesamt sind rund 70 Prozent des Territoriums als gebirgig einzustufen. Die meisten der zahlreichen Moore liegen in Höhen über 400 Metern. Hügeliges Flachland und Küstenebenen prägen die Landschaft Ostenglands. Sie werden von isolierten Hügelketten durchzogen (z. B. die Hambleton Hills in York, die North Downs und South Downs nördlich und südlich von London).
Die höchsten Gipfel der Britischen Inseln befinden sich in Schottland (bis knapp über 1 300 m). Mount Snowdon in den Cambrian Mountains ist mit 1 085 m der höchste Punkt in Wales. Die fast namensgleichen Cumbrian Mountains im Nordwesten Englands erheben sich bis zu einer Höhe von 977 Metern (Scafell Pike im Lake District, höchster Berg Englands).
Landschaften auf Irland
Die mit 84 500 km2 zweitgrößte Hauptinsel Irland baut sich aus einem zentralen, aus unterkarbonischen Kalken bestehenden Flachland auf, welches von Bergländern umrahmt wird. Diese aus paläozoischen Gesteinen aufgebauten Bergländer werden im Südwesten durch tief ins Landesinnere vordringende Meeresbuchten (Riaküste) stark gegliedert. Dort befindet sich mit dem Carrauntoohil (1 039 m) auch der höchste Berg der irischen Insel. Im Landesinneren entstanden während der Eiszeit ausgedehnte Hochmoore. Der Nordwesten Irlands wird durch weitgespannte Ebenen mit einzeln herausragenden Bergkuppen geprägt.
BENELUX-Staaten
Belgien, die Niederlande und Luxemburg liegen im nördlichen Westen Europas, die Niederlande und Belgien grenzen jeweils an die Nordsee.
Niederlande
Rund die Hälfte des Staatsgebiets der Niederlande liegt unterhalb des Meeresspiegels. Der Tiefstwert wird in dem bei Rotterdam mit 6,74 Metern unter dem Meeresspiegel erreicht. Der Kampf mit dem Wasser ist seit jeher eine große Herausforderung für die Niederlande. Über Jahrhunderte wurden dem Meer über 3 000 km2 Land abgerungen, das heute als wichtige Siedlungsfläche dient. Eines der bedeutendsten wasserbaulichen Landgewinnungsprojekte war die Trennung der Zuiderzee, dem heutigen Ijsselmeer, von der Nordsee im Jahr 1932, was einerseits der Neulandgewinnung und andererseits dem Hochwasserschutz diente.
Im Westen der Niederlande reihen sich mehrere Ballungsräume entlang der Küste aneinander, darunter Amsterdam, Den Haag und Rotterdam. Sie bilden zusammen mit Utrecht den Verdichtungsraum Randstad Holland. Rotterdam zählt zu den größten Seehäfen weltweit und stellt den größten Tiefseehafen Europas dar. Im Süden dieses Ballungsraumes bilden Rhein, Schelde und Maas ein ausgedehntes gemeinsames Mündungsdelta.
Belgien
Belgien wird landseitig von Frankreich, Luxemburg, Deutschland und den Niederlanden begrenzt. Im Anschluss an den 65 Kilometer langen Nordseeküstenabschnitt und ihren Dünensaum schließt sich ein 10 bis 20 Kilometer breites Marschland an. Darauf folgt Richtung Südosten eine fruchtbare Tiefebene im Zentrum des Landes, an die sich das höher gelegene Plateau nördlich der Maas und ihres linken Nebenflusses, der Sambre, anschließt. Im Süden durchziehen mehrere Gebirgsketten das Land, die bedeutendste und höchste davon stellen die Ardennen dar (bis zu 650 Metern Höhe).
Luxemburg
Luxemburg gehört mit einer Fläche von 2 590 km2 zu den kleinsten Staaten Europas. Es grenzt an Deutschland, Frankreich und Belgien. Das Ösling, im Norden Luxemburgs, ist Teil der Ardennen und nimmt etwa ein Drittel des Landes ein. Das Gutland im Süden des Landes ist Teil der Lothringer Schichtstufenlandschaft. Dort konzentrieren sich Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft und hier liegt auch die einzige Großstadt des Landes, die Hauptstadt Luxemburg.
Frankreich
Frankreich erstreckt sich vom Atlantischen Ozean im Westen und Nordwesten (Ärmelkanal) bis zum Mittelmeer im Süden. Im Südwesten bilden die Pyrenäen eine natürliche Barriere zur Iberischen Halbinsel (s. 68.1), über ihren Kamm verläuft auch die Grenze zum südlichen Nachbarland Spanien. Ähnlich ist es im Südosten, wo die Westalpen eine natürliche Barriere zur Apenninenhalbinsel bilden und die Grenze nach Italien verläuft (s. 68.1). Weiter nördlich bildet der Jura die Grenze zur Schweiz, gefolgt von der sich nördlich anschließenden Oberrheinischen Tiefebene mit der Grenze zu Deutschland. Im Nordosten grenzt das Land in den Ardennen an Belgien und Luxemburg.
Landschaften in Frankreich
Frankreich umfasst als Kernland Westeuropas weiträumig ebene bis hügelige Tiefländer, Becken und Tafelländer, die durch Atlantik und Mittelmeer, Pyrenäen, Alpen und Vogesen deutlich begrenzt werden. Charakteristisch für das Landschaftsbild Frankreichs ist der Wechsel von eher flachen Mittelgebirgen und ineinander übergehenden Beckenlandschaften. Nur das Zentralmassiv und die Cevennen im Süden sind Mittelgebirge, die größere Höhen erreichen.
Zentrale Landlandschaft ist das Pariser Becken mit seiner weit gespannten Schichtstufenlandschaft, das von der Seine und ihren Nebenflüssen durchbrochen wird. Das Pariser Becken ist umgeben von vier alten Gebirgen: Dem Armorikanischen Massiv im Westen, den Ardennen im Nordosten, den Vogesen im Osten sowie dem Zentralmassiv im Süden.
Das Armorikanische Massiv im Westen erhebt sich in der Bretagne und der Normandie selten höher als 400 Meter, seine überwiegenden Teile erstrecken sich unter 200 Meter Höhe. An der Küste setzen sich zahlreiche Buchten zu einer Riasküste zusammen, die einen großen Tidenhub aufweist.
Die Ardennen im Nordosten an der Grenze zu Belgien und Luxemburg reichen in Frankreich bis etwa 500 Meter Höhe. Sie werden von der Maas durchbrochen.
Die Vogesen im Osten gehören geologisch zum paläozoischen Variskischen Gebirge und sind kristallinen Ursprungs. Sie erreichen im 1 424 Meter hohen Großen Belchen ihren höchsten Gipfel.
Das sich südlich anschließende Kalkgebirge Jura ist Namensgeber für das mesozoische Erdzeitalter und erreicht im südwestlichen Cret de la Neige eine Höhe von 1 720 Meter. Am Jura hat Frankreich westlich Anteil (östlich die Schweiz), ebenso wie an den südlich folgenden Westalpen (östlich Italien). Hier befindet sich mit dem Mont Blanc, dessen Hauptgipfel auf französischem Gebiet liegt, Europas höchster Berg (4 810 Meter).
Zwischen den Vogesen, dem Jura und den Westalpen im Osten sowie den burgundischen Randgebirgen und dem Zentralmassiv im Westen liegt eine breite Grabenzone, der die Flüsse Saône und Rhône folgen. Sie verläuft in Nord-Süd-Richtung und wird dabei sukzessive enger und tiefer. Das Zentralmassiv und südlich davon die Cevennen (1 699 m) begrenzen das Rhônetal durch hohe, steil und scharf zerschnittene Ostflanken, während beide von Westen und Norden her eher sanft ansteigen. Im Norden wird das Zentralmassiv vom Oberlauf der Loire und des Allier in breiten Gräben zerschnitten. Auf der Auvergne, der Rumpffläche des Zentralmassivs, erheben sich westlich des Alliertals Reste von Vulkanen wie dem Puy de Sancy, der mit 1 885 Metern höchsten Erhebung des Zentralmassivs.
Zwischen dem Zentralmassiv und den Pyrenäen erstreckt sich das Aquitanische Becken, nach dem Pariser Becken das zweitgrößte Sedimentbecken Frankreichs.
Im Südwesten reicht Frankreich bis auf den Kamm der Pyrenäen, über den auch die Grenzen zu Andorra und Spanien verlaufen.
Mitteleuropa
Mit dem Begriff Mitteleuropa wird – im buchstäblichen Sinn – der zentrale Teil des Kontinents Europa bezeichnet, die Abgrenzung ist aber nicht überall scharf und eindeutig. Naturräumliche und klimatische Abgrenzungen sowie Abgrenzungen hinsichtlich der Vegetation fallen anders aus als historische oder politische Grenzen.
Im Westen und Nordwesten kann der Rhein als natürliche Grenze zu Westeuropa herangezogen werden. Im Norden dienen die Küsten von Nord- und Ostsee zur Abgrenzung von Mittel- und Nordeuropa (s. 60.3). Im Süden bilden die Zentralalpen und die aus ihnen nach Osten entwässernde Drau gemeinhin die Grenze zwischen Mittel- und Südeuropa. Insbesondere zu Osteuropa (s. 76.1) ist die Abgrenzung aber unscharf, hier werden häufig die Flüsse Bug und Theiß als Grenzlinie herangezogen, ob aber tatsächlich Flüsse geeignet sind, um Teilkontinente festzulegen, ist umstritten. Dennoch, derart abgegrenzt zählen folgende Länder zu Mitteleuropa: Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, sowie kleine Teile von Slowenien, Kroatien und der Ukraine.
Landschaftliche Vielfalt Mitteleuropas
Mitteleuropa ist topographisch und naturräumlich sehr vielfältig mit Küsten, weiten Tiefländern (in der Karte in grünen Farbtönen dargestellt), Mittelgebirgen (in gelben bis beigen Farbtönen dargestellt) und Hochgebirgsräumen (in orangenen bis braunen Farbtönen dargestellt). Die Mittelgebirge zählen zum Teil zum variszischen Grundgebirge (ca. 300 Mio. Jahre alt), zum Teil zum mesozoischen Deckgebirge, sofern jüngere Sedimentauflagen erhalten geblieben sind. Lokal finden sich auch junge Vulkangebiete. Die Hochgebirgsräume Mitteleuropas gehen auf die alpidische Gebirgsbildung zurück, die an der Wende von der Unter- zur Oberkreide vor rund 90 Mio. Jahren begann und gegen Ende des Tertiärs im späten Miozän die höchste Aktivität der Hebung erreichte. Zur topographischen Heterogenität kommt hinzu, dass es sich klimatisch um einen Übergangsraum handelt, der zwischen dem kalten Nordeuropa und dem warmen Süden sowie dem maritimen Westeuropa und dem kontinentalen Osteuropa vermittelt. Daraus ergeben sich unterschiedliche Landschaftseinheiten und Landschaftstypen, die Mitteleuropa charakterisieren.
Den Norden Mitteleuropas prägen die Küstenlandschaften mit ihren vorgelagerten Inseln sowie die südlich anschließenden Tiefländer. Diese Regionen sind von den Eiszeiten und der Nacheiszeit geprägt. Mächtige Gletscher des skandinavischen Eisschildes schufen während der pleistozänen Eiszeiten in Mecklenburg-Vorpommern und in Masuren (Polen) weite Seenlandschaften. Im Westen reichte die maximale Ausdehnung der Vereisung bis südlich von Berlin, im Osten etwa bis Lemberg. Südlich der vergletscherten Bereiche entstand ein breiter Lössgürtel, der heute die Grundlage einer ausgedehnten landwirtschaftlichen Nutzung ist. Nach Süden hin schließen sich an die glazial geprägten Tiefländer die großräumigen Mittelgebirgslandschaften, die in Deutschland unter anderem mit Harz, Eifel, Hunsrück, Taunus, Thüringer Wald, Schwarzwald und Bayerischem Wald besonders vielfältig und abwechslungsreich sind. Auch Tschechien und die Slowakei sind stark von Mittelgebirgen geprägt. An der Grenze zwischen der Slowakei und Polen findet sich die gemeinhin als kleinstes Hochgebirge des Kontinents bezeichnete Hohe Tatra (bis 2 654 m), obwohl auch die Schneekoppe (1 603 m) im Riesengebirge und lokal die Waldkarpaten Hochgebirgszüge tragen. Die sehr viel größeren Alpen grenzen Mitteleuropa im Südwesten (s. 68.1) zum Mittelmeerraum mit seinem bereits subtropischen Klima ab, im Südosten (s. 72.1) liegen die weitgespannten Tiefländer der ungarischen Puszta.
Klimagradienten innerhalb Mitteleuropas
Mitteleuropa liegt durchweg im Bereich der gemäßigten Klimazone, es bestehen aber ausgeprägte Klimagradienten von Nord nach Süd und von West nach Ost. In Nordeuropa (s. 60.3) herrscht ein kühlgemäßigtes bis kaltes Klima vor, während Südeuropa (s. 68.1 und 72.1) ein mildes, mediterranes Klima aufweist. In Westeuropa ruft der Einfluss des nahen Atlantiks ein maritim geprägtes Klima hervor, das von moderaten Temperaturen und geringen Temperaturamplituden gekennzeichnet ist. Das kontinentale Klima Osteuropas (s. 76.1) ist dagegen geprägt von kalten Wintern und heißen Sommern. Innerhalb Mitteleuropas vollziehen sich die Übergänge zwischen diesen Extremen: Von Nord nach Süd steigen die Temperaturen sukzessive an und der maritime Einfluss, der ein mildes, ausgeglichenes Klima schafft, nimmt von West nach Ost ab; die Kontinentalität, die wärmere Sommer, aber auch längere und kältere Winter hervorruft, nimmt entsprechend zu. Klimatisch ist der mitteleuropäische Raum also ein Übergangsbereich.